
Königin aus der Nachbarschaft
Meckenheimer Stadtmuseum veröffentlicht Heft über Richeza von Polen
Meckenheim. Sie lebte auf der Tomburg, heiratete einen Adligen aus der Piastendynastie und wurde Königin Polens: Richeza, lange von der Geschichtsschreibung vergessen, gilt heute als Symbol der deutsch-polnischen Freundschaft. Dieter Ohm, der Vorsitzende des Vereins Stadtmuseum und Kulturforum Meckenheim, hat die Fakten zusammengetragen und dieser historischen Figur aus dem 11. Jahrhundert eine Publikation gewidmet.
Es gibt keine zeitgenössischen Porträts, Richezas Geburtsdatum ist nicht bekannt, der Tag der Hochzeit ebensowenig. Bei der Heirat mit dem Herzogsohn und späteren König Mieszko II. soll sie 18 Jahre alt gewesen sein. Ihre Mutter Mathilde war eine Tochter des deutschen Kaisers Otto II. und somit aus höchstem Adel, ihr Vater Ezzo Pfalzgraf von Lothringen; das Ehepaar hatte seinen Wohnsitz in der Tomburg. Richeza, die älteste Tochter, wurde schon als Kind ihrem späteren Ehemann versprochen, eine zeittypische politische Hochzeit mit dem Ziel, Bündnisse zu stärken und Konflikte zu befrieden. Die Braut reiste weit nach Osten und begann ein neues Leben, dessen Herausforderungen sie offenbar willig annahm. 1026, nachdem König Boleslaw I. gestorben war, bestiegen Mieszko und Richeza den Königsthron.
Ob die Ehe glücklich war oder nicht, darüber gibt es keine Zeugnisse. Mieszko ließ seine Frau oft allein, sie widmete sich der Erziehung des Sohnes Kasimir und ihrer Töchter Richeza und Gertrud. 1034 starb Mieszko, Richeza übernahm die Regentschaft für ihren Sohn. Als Unruhen ausbrachen, verließen Mutter und Sohn Polen. Die Witwe lebte zeitweise bei ihrem Bruder, dem Erzbischof Hermann II. von Köln, hielt sich auch immer wieder auf der Tomburg auf und besuchte ihre Besitztümer in Meckenheim. Ihr Sohn kehrte später nach Polen zurück und wurde dort als Herzog Kasimir I. zum „Erneuerer Polens“. Ihre beiden Töchter heirateten standesgemäß – die eine den König von Ungarn, die andere den Großfürsten von Kiew.
Die königliche Witwe stiftete der Abtei Brauweiler eine neue Klosterkirche und Besitztümer unter anderem in Gelsdorf, Altendorf, Wormersdorf und Meckenheim. Sie wollte in der Klosterkirche beerdigt werden, tatsächlich ist ihr Grab aber heute im Kölner Dom.
Das Heft „Richeza, Königin von Polen – Eine rheinische Pfalzgrafentochter mit Verbindungen zu Meckenheim und Rheinbach“ ist gegen eine Schutzgebühr von 5 Euro im Stadtmuseum im Herrenhaus der Burg Altendorf, im Buchladen am Neuen Markt sowie beim Autor persönlich erhältlich. Kontakt: Telefon:02225-910777, Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Bildtext:
Die Darstellung Richezas auf dem Titel des Heftes stammt aus dem 19. Jahrhundert. Zeitgenössische Porträts sind nicht bekannt. (Foto: Meckenheimer Stadtmuseum und Kulturforum)




 In diesem Buch spannt sich der Bogen der gesellschaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und kirchlichen Entwicklung vom Kriegsende bis zum Jahr 2018. Die „alten“ Meckenheimer bemühten sich zuerst, die gewaltigen Kriegsschäden zu beseitigen und die kleine Stadt wieder lebensfähig zu machen. Mit der Gründung der Bundesrepublik und dem wirtschaftlichen Aufschwung sahen sie einer enormen Zuwanderung entgegen und ergriffen zusammen mit Merl kraftvoll die Initiative zur Schaffung einer neuen Stadt.
In diesem Buch spannt sich der Bogen der gesellschaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und kirchlichen Entwicklung vom Kriegsende bis zum Jahr 2018. Die „alten“ Meckenheimer bemühten sich zuerst, die gewaltigen Kriegsschäden zu beseitigen und die kleine Stadt wieder lebensfähig zu machen. Mit der Gründung der Bundesrepublik und dem wirtschaftlichen Aufschwung sahen sie einer enormen Zuwanderung entgegen und ergriffen zusammen mit Merl kraftvoll die Initiative zur Schaffung einer neuen Stadt.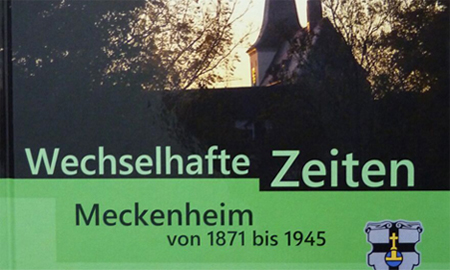 Zu Beginn werden die Gründerjahre, vielfach auch als die glücklichen Jahre bezeichnet, geschildert. Es war die Zeit als Meckenheim aufblühte, an die Eisenbahn angeschlossen wurde, elektrisches Licht, Telegrafie und Telefon bekam. Es folgte der Erste Weltkrieg mit seinen vielen Opfern und der Notzeit, die bis zum Ende der 20er Jahre dauerte, mit Hunger, Armut und Inflation und der Besetzung durch englische und französische Truppen.
Zu Beginn werden die Gründerjahre, vielfach auch als die glücklichen Jahre bezeichnet, geschildert. Es war die Zeit als Meckenheim aufblühte, an die Eisenbahn angeschlossen wurde, elektrisches Licht, Telegrafie und Telefon bekam. Es folgte der Erste Weltkrieg mit seinen vielen Opfern und der Notzeit, die bis zum Ende der 20er Jahre dauerte, mit Hunger, Armut und Inflation und der Besetzung durch englische und französische Truppen.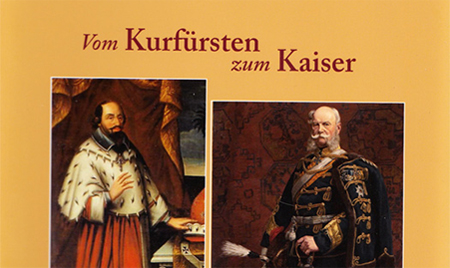 In diesem Buch spannt sich der Bogen der Meckenheimer Geschichte von dem 30jährigen Krieg mit der Erhebung zur Stadt durch den Kölner Kurfürsten, aber auch Plünderungen und Brandschatzungen, bis hin zur Kaiserproklamation im Januar 1871 in Versailles. Es schließt damit an „Die Ur-Meckenheimer“ an – dem zweiten Buch des Meckenheimer Stadtmuseums – welches die Zeitspanne von der ersten Besiedlung bis zur Verleihung der Stadtrechte behandelt.
In diesem Buch spannt sich der Bogen der Meckenheimer Geschichte von dem 30jährigen Krieg mit der Erhebung zur Stadt durch den Kölner Kurfürsten, aber auch Plünderungen und Brandschatzungen, bis hin zur Kaiserproklamation im Januar 1871 in Versailles. Es schließt damit an „Die Ur-Meckenheimer“ an – dem zweiten Buch des Meckenheimer Stadtmuseums – welches die Zeitspanne von der ersten Besiedlung bis zur Verleihung der Stadtrechte behandelt.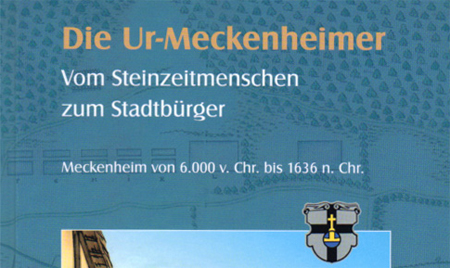 In dem Buch wird geschildert, warum die Menschen in der Frühzeit hier siedelten. Wasser, Wald mit Tieren und Holz zum Hausbau, fruchtbare Böden für Weiden und Ackerbau und kaum feindliche Nachbarn – das waren ideale Gegebenheiten. Später kamen die Römer und Franken, deren Siedlungen in diesem Gebiet durch viele Ausgrabungen nachgewiesen werden konnten. 853 dann die erste urkundliche Erwähnung, als der Priester Herigard seinen Besitz in Meckedenheim dem Cassius Stift überschrieb.
In dem Buch wird geschildert, warum die Menschen in der Frühzeit hier siedelten. Wasser, Wald mit Tieren und Holz zum Hausbau, fruchtbare Böden für Weiden und Ackerbau und kaum feindliche Nachbarn – das waren ideale Gegebenheiten. Später kamen die Römer und Franken, deren Siedlungen in diesem Gebiet durch viele Ausgrabungen nachgewiesen werden konnten. 853 dann die erste urkundliche Erwähnung, als der Priester Herigard seinen Besitz in Meckedenheim dem Cassius Stift überschrieb.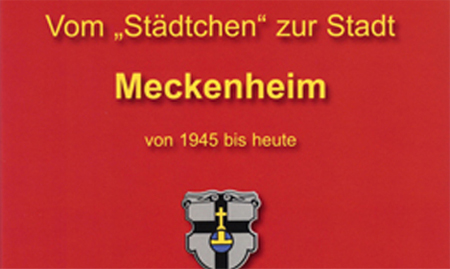 Das Buch beginnt mit der fast vollständigen Zerstörung der Stadt in den letzten Monaten des Krieges, gefolgt vom anschließenden Wiederaufbau. Geschildert werden dann die Überlegungen zum Aufbau einer „Neuen Stadt“ und ihrer Verschmelzung mit den alten Ortskernen von Meckenheim und Merl sowie der späteren Erweiterung um Altendorf, Lüftelberg und Ersdorf durch die kommunale Neuordnung.
Das Buch beginnt mit der fast vollständigen Zerstörung der Stadt in den letzten Monaten des Krieges, gefolgt vom anschließenden Wiederaufbau. Geschildert werden dann die Überlegungen zum Aufbau einer „Neuen Stadt“ und ihrer Verschmelzung mit den alten Ortskernen von Meckenheim und Merl sowie der späteren Erweiterung um Altendorf, Lüftelberg und Ersdorf durch die kommunale Neuordnung.